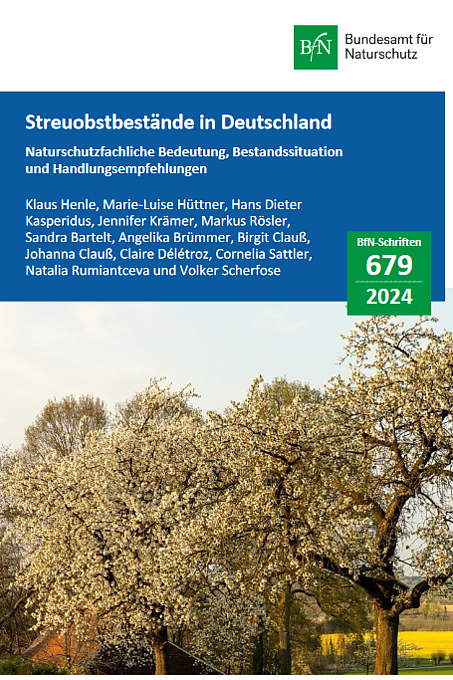Machen Sie der Natur ein Geschenk.
Spenden Sie für den Natur- und Artenschutz!
Fachliteratur
Lesenswertes zum Streuobst

Buch mit Apfel - Foto: Pixabay
Übersicht:
“Streuobstbestände in Deutschland“, Grundsatzstudie, BfN-Schriften 679, NABU / Umweltforschungszentrum Leipzig / BfN, 2024
“Naturkapital Streuobstwiese – Ökosystemleistungen – Monetarisierung – Folgerungen“, Studie, Aktionsbündnis Biodiversität im Landkreis Görlitz von der Stiftung IBZ St. Marienthal und Oberlausitz-Stiftung, Michael Schlitt & Matthias Kramer 2024
“Analyse der Aufpreisvermarktung von Streuobst: Vergleich von Praxisbeispielen in den Bundesländern Sachsen und Baden-Württemberg“, Masterarbeit, TU Dresden, Kristin Bückers 2024
“Auswirkung staatlicher Fördermaßnahmen auf Erhalt und Pflege von Streuobstbeständen im Land Brandenburg – eine Situationsanalyse“, Masterarbeit Humboldt-Universität Berlin, Steffen Wolff 2023
“Der Schutz von Streuobstwiesen als gemeinsame Herausforderung für Politik und Zivilgesellschaft – Faktoren für nachhaltigen Streuobstbau in Bayern“, Masterarbeit Universität Augsburg, Miriam Köhler 2023
“Gelingt der Ausgleich? Evaluierung des Kompensationsmaßnahmentyps 'Anlage von Streuobstwiesen' in Mecklenburg-Vorpommern“, Bachelorarbeit, Universität Greifswald, Philipp Angst 2024
Streuobstbestände in Deutschland
Grundsatzstudie zum Streuobstbau in Deutschland
Wie viel Streuobstbestände gibt es noch in Deutschland? Wie viele Arten welcher Artengruppen wurden in den Streuobstbeständen Deutschlands nachgewiesen? Wie lauten die unterschiedlichen Definitionen seit den 1980er Jahren und wie lauten empfehlenswerte Definitionen für den gesetzlichen Schutz und für Förderprogramme? Welche Gefährdungsursachen sind besonders relevant und welche Maßnahmen sollten die EU, die Bundesrepublik, die Länder... ergreifen, um Streuobstbestände zu erhalten und zu fördern?
Diese und viele weitere Themen haben Expert*innen vom NABU gemeinsam mit Wissenschaftler*innen vom Umweltforschungszentrum Leipzig bearbeitet in einem vom Bundesamt für Naturschutz geförderten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben „Streuobstbestände in Deutschland“.
Die komplette Studie kann beim BfN heruntergeladen werden: https://www.bfn.de/publikationen/bfn-schriften/bfn-schriften-679-streuobstbestaende-deutschland
„Streuobstbestände in Deutschland“, BfN-Schriften 679, 2024, 157 S.
Der wirkliche Wert einer Streuobstwiese
163.000 Euro pro Jahr und Hektar
Am Beispiel einer 2,5 ha großen Streuobstwiese im sächsischen Ostritz-Leuba wird deren volkswirtschaftlicher Wert berechnet - wissenschaftlich sehr solide. Auftraggeber war das Aktionsbündnis Biodiversität im Landkreis Görlitz von der Stiftung IBZ St. Marienthal und die Oberlausitz-Stiftung. Die Autoren Dr. Michael Schlitt und Prof. Dr. Matthias Kramer weisen einen Wert von 163.000 Euro pro Jahr und Hektar nach - als Durchschnittswert über 10 Jahre. Bei diesem „Naturkapital Streuobstwiese“ spielen finanziell insbesondere Kohlenstoffbindung und Wasser (Erosions-, Trinkwasser- und Hochwasserschutz) eine große Rolle, aber auch Bestäubung, Verbesserung des lokalen Kleinklimas und kulturelle Leistungen.
Der Verkauf der Produkte wie Obst, Honig, Heu, Holz spielt hierbei finanziell keine große Rolle.
Mitgerechnet werden die Ausgaben im Zusammenhang mit Bewirtschaftung - allerdings am Beispiel der o.g. 17 Jahre alten Streuobstwiese, also in diesem Punkt nur vereinzelt übertragbar.
Unterm Strich ein ganz wichtiges Grundlagenwerk für den Streuobstbau in Deutschland und darüber hinaus.
Rezension: Markus Rösler
Die komplette Studie „Naturkapital Streuobstwiese – Ökosystemleistungen - Monetarisierung – Folgerungen“ kann bei der Oberlausitz-Stiftung kostenlos heruntergeladen werden:
https://www.oberlausitz-stiftung.de/naturkapital-streuobstwiese/
Analyse der Aufpreisvermarktung von Streuobst: Vergleich von Praxisbeispielen in den Bundesländern Sachsen und Baden-Württemberg
Masterarbeit Kristin Bückers TU Dresden
Die Autorin stellt nach einem kurzen Einblick in Aspekte des Klimawandels beim Streuobstbau die Fördermöglichkeiten für Streuobstbäume (nicht für Grünland bzw. Streuobst-Unternutzung) in BW und Sachsen vor - in BW exemplarisch an (nur) drei Förderprogrammen.
Sehr anschaulich sind die beiden Karten der Bundesländer von Baden-Württemberg und Sachsen mit der Dichte der Streuobstbestände.
Schwerpunkt der Arbeit sind fünf Befragungen mit Expert/innen aus Sachsen und Baden-Württemberg zur Streuobst-Aufpreisvermarktung, die systematisch ausgewertet werden. Hohes Alter der Bewirtschafter, teils abnehmendes ehrenamtliches Engagement in den Initiativen, fehlende Nachpflanzungen, zu niedrige Preise für das Mostobst, mangelnder Erfolg beim Absatz auch wegen der Konkurrenz von Bio-Plantagensaft sind dabei häufig genannte Aspekte, bei denen Veränderungs- bzw. Verbesserungsbedarf besteht. Länderübergreifend wir der Bedarf an mehr positiver Werbung durch die Bundesländer gesehen.
Ehrenamt mit seinen positiven und schwierigen Seiten bei unternehmerisch angelegten Projekten spielt in BW eine viel größere Rolle als in Sachsen. Auch wird in BW laut Aussagen der Autorin eher der LEH und Getränkehandel beliefert - bei meist etwas größeren Streuobst-Projekten. In Sachsen sind Verbrauchergemeinschaften und kleinere Strukturen charakteristischer.
Weitere Aspekte wie Labeling, Wertschöpfungsketten, Klimawandel, Regionalität, Aufpreisbereitschaft, Förderoptionen durch die Öffentliche Hand... werden in der Diskussion thematisiert.
Rezension: Markus Rösler
Kristin Bückers, Masterarbeit TU Dresden, 115 S.
Auswirkung staatlicher Fördermaßnahmen auf Erhalt und Pflege von Streuobstbeständen im Land Brandenburg – eine Situationsanalyse
Masterarbeit Steffen Wolff 2023 Humboldt-Universität Berlin
Aus der Praxis für die Praxis: Elf Bewirtschafter*innen, teils Landwirt*innen, teils Obstbaumpfleger*innen, teils gemeinnützige Vereine… hat Steffen Wolff zur Streuobst-Pflege und Qualität sowie Eignung der Förderung der Streuobstbestände in Brandenburg befragt – samt sehr übersichtlich strukturierter tabellarischer Darstellung der elf unterschiedlichen Betriebe/Betriebsformen. Dies hat er eingewoben in den Rahmen zahlreicher konkret benannter einschlägiger Gesetze und Verordnungen sowie umfangreicher einschlägiger Literatur aus ganz Deutschland – gut recherchiert!
Gut strukturiert von der EU-Ebene (Direktzahlung, Leader…) zur nationalen Ebene (GAK…) zur Landesebene (KULAP, Landschaftspflegerichtlinie, Ausgleichsmaßnahmen…) schildert der Autor die Rahmenbedingungen für den Streuobstbau in Textform samt tabellarischer Übersicht.
Basiert auf den Befragungen sowie eigenen Einschätzungen erfolgt eine Auseinandersetzung sowohl mit harten ökonomischen Fakten und Zahlen wie mit „weichen“ völlig subjektiven Anmerkungen und Anregungen: Eine erfreulich offene, kritische Auseinandersetzung mit der Fördersituation in Brandenburg – bis hin zu einem eigenen Unterkapitel „Intransparenz und Fehlinformation“: In der Qualität und Konkretisierung absolut vorbildlich nicht nur für andere wissenschaftliche, sondern jegliche Arbeiten. Allein am Beispiel des KULAP Brandenburg wird die Kritik in acht unterschiedlichen Feldern kategorisiert. Die Zitate und Infos zu Mindestschlaggröße, Maßnahmenkombinationen, Grünlandnutzung, Zuwendungsberechtigung, Sortenvielfalt, Stammhöhe, Definition, Bürokratie etc. beinhalten einen außerordentlich bunten, sehr praktischen Strauß an Informationen zur Verbesserung der (Förder-)Situation in Brandenburg inklusive konkreter Angaben zu den wünschenswerten Höhen unterschiedlicher Fördermaßnahmen, dies zudem sehr weitgehend übertragbar auf andere Regionen Deutschlands und darüber hinaus.
Die Fördersituation im Streuobstbau sowie die Situation des Streuobstbaus in Brandenburg wie in Deutschland lassen den Schluss zu, dass viel Handlungsbedarf besteht. Die vorliegende Arbeit bietet hierzu eine ganz hervorragende Grundlage. Und dies sowohl was die Analyse, als auch was die Bewertung und die Handlungsempfehlungen betrifft!
Rezension: Markus Rösler
Steffen Wolff, Masterarbeit Humbold-Universität Berlin, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften, 2023, 114 S.
Der Schutz von Streuobstwiesen als gemeinsame Herausforderung für Politik und Zivilgesellschaft – Faktoren für nachhaltigen Streuobstbau in Bayern
Masterarbeit Miriam Köhler 2023 Universität Augsburg
Der vorliegenden Arbeit diente als Aufhänger der bayerische Streuobstpakt mit dem Ziel, den Streuobstbau in Bayern nachhaltig zu fördern.
Hierzu durchleuchtet die Autorin die aktuelle EU-Agrarpolitik (GAP) im Hinblick auf den Streuobstbau samt kritischer Recherche zum Einsatz von Pestiziden, beleuchtet die Diskussion um Definition und Erkenntnisse im Bereich der Ökologie.
Zahlreiche Experteninterviews dienen als Grundlage für eine Auswertung hinsichtlich Problemen und Handlungsbedarf im Streuobstbau, übersichtlich strukturiert in 12 Themenbereiche: Von der emotionalen Bindung über Freizeitverhalten, Vernetzung, Bürokratie, Fachwissen, Ökologie, Baumpflege, Vermarktung...
Dies diskutiert die Autorin mit einem Schwerpunkt-Blickwinkel auf soziokulturelle Zusammenhänge und der Frage, wie der Bayerische Streuobstpaket diesbezüglich einzuschätzen ist. Handlungsempfehlungen runden diese rundum gelungene Masterarbeit ab.
Rezension: Markus Rösler
Masterarbeit Miriam Köhler 2023 Universität Augsburg, 108 S. + V.S.